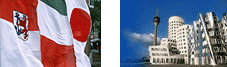Kultur und Austausch
Sommerimpressionen:
(Japan Forum, August 2002, S. 1-2)
Wer sich die traditionelle japanische Bauweise anschaut und für längere Zeit in einem derartigen Gebäude gewohnt hat, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die einheimische Bevölkerung offensichtlich den langen, schwülheißen Sommer weit mehr fürchtet als die Kälte des vergleichsweise kurzen Winters. In Japan ist die Ansicht relativ weit verbreitet, gegen Kälte könne man sich durch entsprechende Kleidung wirkungsvoll schützen, Hitze hingegen sei schwer zu ertragen. Die Häuser scheinen eher darauf ausgerichtet zu sein, Luft durchzulassen anstatt wirkungsvoll vor Durchzug zu schützen. So schlottert der an eine effektiv arbeitende Raumheizung gewohnte westliche Besucher in Japan nicht selten in den kühleren Monaten, wenn der Wind durch die Ritzen der meist nicht exakt schließenden Fenster und Türen dringt und es einfach nicht recht warm werden will. Mancher fragt sich sogar verwundert, warum es den Japanern nicht gelungen sei, "anständig isolierte Gemäuer" mit einem gut funktionierenden Heizungssystem zu bauen. Doch dass man dies in Japan durchaus kann, zeigt ein Blick nach Nordjapan, wo das selbstverständlich ist, was in den übrigen Landesteilen eher die Ausnahme darstellt: eine Zentralheizung - und diese existiert dort übrigens im Gegensatz zum restlichen Japan auch in den Gefängnissen.
Es liegt also nicht daran, dass man nicht entsprechend bauen könnte. Vielmehr handelt es sich um eine bewusste Entscheidung angesichts der klimatischen Verhältnisse in den Sommermonaten, wenn - von Hokkaido abgesehen - Japan von einer mehrwöchigen Regenzeit und vor allem von großer Hitze heimgesucht wird. Da ist man dankbar für jedes Lüftchen, das durch die Räume streicht. Um es ja nicht zu versäumen, werden im Sommer gern Windglöckchen (furin) draußen vor dem Haus oder auch an den Dachtraufen von Tempeln aufgehängt. An ihnen ist oft ein Papierstreifen befestigt, der dafür sorgt, dass auch der kleinste Luftzug wahrgenommen wird und das Glöckchen zum Klingen bringt. Selbst wenn der Hauch nicht bis zum Bewohner gelangt, kann dieser ihn doch zumindest hören, wenn nicht spüren, und erhält damit zumindest akustisch den Eindruck von Frische.
Dabei geht es nicht ausschließlich um das Wohlbefinden der Menschen, sondern auch um ganz praktisch-materielle Erwägungen: Lang überhängende Dächer schützen das Innere vor Regen und Sonnenstrahlen. Möchte man nicht, dass sich aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit Schimmel im Haus breit macht und Kleidung aus Pflanzenfasern, Lederwaren und manche sonstigen Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände befällt, ist es wichtig, alles regelmäßig gut auszulüften. Der eine oder andere Europäer hat schon ein böses Erwachen erleben müssen, als er Ende des Sommers seine Winterschuhe aus dem Schrank holte, deren Konsistenz sich unangenehm verändert hatte; oder er durfte im Laufe der Zeit feststellen, dass es offensichtlich ein Fehler war, sein japanisches Bettzeug, den Futon, nicht - wie dies die Einheimischen zu tun pflegen - bei jeder sich bietenden Gelegenheit zum Trocknen in die Sonne hinausgehängt zu haben.
Traditionelle japanische Bauten verfügen weder über einen Keller noch schliesst der Fußboden unmittelbar an den Untergrund an, sondern liegt deutlich erhöht, so dass unter ihm die Luft zirkulieren kann, das Haus von unten gekühlt wird und gerade in der Regenzeit die Reisstrohmatten (tatami) vor Fäulnis bewahrt werden. Begünstigt wird all dies außerdem durch den Einsatz natürlicher, atmungsaktiver Materialien wie Holz, Bambus und Papier. Viele der Außen- und Zwischenwände sind mit Schiebetüren versehen, die man öffnen und auf Wunsch sogar herausnehmen und so mit Beginn der feuchten Sommerhitze relativ einfach für Durchzug sorgen kann. In modernen Betonwohnungen, in denen diese Möglichkeit oft fehlt, kann es hingegen passieren, dass die Wände "schwitzen", also Wasser absondern. Moderne Klimaanlagen, die im Sommer kalte Luft ins Zimmer blasen, sollen dem entgegenwirken. Sie finden sich selbstverständlich auch in Büroräumen, Zügen und Autos, sorgen bei japanunerfahrenen Fremden allerdings oft für eine deftige Erkältung, da sie sich für den Innenbereich zu leicht angezogen haben. Dies gilt auch für die Ventilatoren, die im Sommer ebenfalls in nahezu jedem Haushalt zu finden sind, um für die ersehnte Kühlung zu sorgen. Man sollte daher auch bei 35-40°C Außentemperatur eine Jacke mitnehmen, um sich flexibel auf die jeweiligen Klimaverhältnisse einstellen zu können.
Der Vorteil der traditionellen Bauweise im Sommer entpuppt sich im Winter allerdings als gewisser Nachteil. Denn dann wird spürbar, dass die mit Japanpapier (washi) bespannten, lichtdurchlässigen Schiebetüren (shôji) nicht richtig luftdicht schließen und nur bedingt Kälte abhalten. Die Wandschirme (byôbu), die früher häufig zum Mobiliar gehörten, dienten daher einst nicht nur der dekorativen Verschönerung des Raumes sowie als Sichtschutz, hinter dem die Damenwelt das Geschehen verfolgen konnte, ohne sich neugierigen Blicken auszusetzen; zugleich hielten sie in der kühleren Jahreszeit auch unangenehme Zugluft ab.
Für traditionell eingerichtete Zimmer im japanischen Stil (washitsu) sind die oben erwähnten Tatami, bei denen der fest auf ca. 6 cm Dicke zusammengepresste Reisstrohkern durch eine Binsenmatte abgedeckt und durch seitlich angenähte Baumwollbänder fixiert wird, der perfekte Bodenbelag, und dies nicht nur aus ästhetischen Gründen. Sie sind atmungsaktiv, halten im Winter warm und im Sommer kühl, absorbieren - wie Forscher herausgefunden haben - bei hoher Luftfeuchtigkeit bis zu 500cc Wasser pro Matte und geben bei Trockenheit diese Feuchtigkeit wieder nach außen ab. Der chinesischen Medizin zufolge sollen Tatami überdies das Gemüt beruhigen und für Entspannung sorgen, zumal das Material etwas nachgibt und daher den idealen Untergrund für den Futon darstellt.
Es ist also in Japan gelungen, im Laufe der Zeit durch Einsatz bestimmter Bauelemente beste Voraussetzungen zu schaffen, um mit den extremen klimatischen Bedingungen im Sommer zurechtzukommen, und dabei das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Wer in dieser Jahreszeit in einem traditionellen japanischen Haus wohnt, lernt diese Möglichkeiten zu schätzen, zumal der Blick durch geöffnete Schiebetüren in den Garten einen oft für andere Unannehmlichkeiten entschädigt.
Ein typisches Sommerutensil, das wir heutzutage vor allem - wenn auch nicht ausschließlich - in Frauenhand finden, ist der Fächer, mit dem man sich an stickigen Tagen Linderung verschaffen kann. Es existieren zahllose Fächervarianten, hinter denen ganz unterschiedliche Verwendungszwecke stehen, z.B. der stabile mai-ôgi, der beim Tanzen eingesetzt wird, der chukei, mit dem der Nô-Schauspieler seine Gesten unterstreicht, und der relativ schlichte Rikyu-ôgi, auf dem der Teemeister während der Teezeremonie Süßigkeiten wie auf einem Tablett serviert. Im militärischen Bereich gibt es den mit Eisenlamellen versehenen oder zumindest verstärkten gunsen oder tessen, einen Kampffächer, der in der Muromachi-Zeit (1333-1573) aufkam und als Waffe fungieren konnte, sowie den festen gunbai-uchiwa mit Eisengriff, eine Art Kommandostab der Feldherren. Mit Letzterem soll es TAKEDA Shingen (1521-1573) einst in der 4. Schlacht von Kawanakajima (1561) gelungen sein, sich seines Erzrivalen UESUGI Kenshin so lange zu erwehren, bis ihm seine Gefolgsleute zu Hilfe eilen konnten. Als eine Sonderform des Fächers sollte der riesige, bis zu ca. 2 m lange mita-ôgi nicht vergessen werden, der von Feuerwehrleuten bei der Prozession zu Ehren der Sonnengöttin zum Ise-Schrein getragen wird. Der am Hofe übliche, anfangs dem japanischen Kaiser vorbehaltene Zeremonialfächer wird hiôgi genannt; er wurde später zum unentbehrlichen Bestandteil der Hoftracht und gehörte somit zu allen Feierlichkeiten hinzu. Noch heute begegnet uns der Fächer in seiner zeremoniellen Funktion beispielsweise bei einer Shintô-Hochzeit oder bei der Krönungsfeier des japanischen Kaiserpaars.
Fächer waren und sind noch heute ein beliebtes Geschenk und Mitbringsel. Mit der Entwicklung des Holzschnitts (ukiyo-e) in der Edo-Zeit (1603-1867) nutzten Künstler den Fächer als Malfläche verstärkt für die nun populären Alltagsszenen, so dass diese oft sehr dekorativ gestaltet wurden. Noch heute zeugt manch kostbares Exemplar in Museen und Sammlungen vom Talent der Künstler. Mit der Öffnung Japans zum Westen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs auch das Interesse Europas und Amerikas an japanischen Fächern, die man daher bald gezielt für diesen neuen Markt in Übersee produzierte, auf dem sich Fächer als eine Art Exportschlager entpuppten. Als Hauptmaterialien dienten dabei Bambus für den Rahmen sowie Papier oder Stoff für die Fläche dazwischen.
Im Laufe der Zeit wurden die Modelle immer feiner ausgearbeitet, auch entstand manch neue Form. Dennoch sind bis heute zwei Fächertypen besonders verbreitet: der feste, flache Blattfächer (uchiwa) und der Klapp- oder Faltfächer (ôgi oder sensu). Ersterer, dessen Form auf das Palmblatt zurückgeht, soll im 6. Jahrhundert aus China über Korea nach Japan gelangt sein. Er ist leicht herzustellen und wurde aufgrund seiner großen, stets sichtbaren Fläche schon frühzeitig zu einem beliebten Werbeträger, den Firmen bis heute gern zu Reklamezwecken nutzen und kostenlos verteilen. Der als eleganter geltende Klappfächer hingegen, der einst platzsparend in den großen Gewandärmeln verstaut werden konnte, gilt als rein japanische Erfindung. Seine Entstehung wird auf die Zeit des Kaisers Tenji (reg. 661-672) zurückgeführt, in der ein Fächermacher sich den Flügel einer Fledermaus zum Vorbild genommen und danach den ersten Faltfächer gefertigt haben soll. Einer anderen Legende zufolge befreite die Witwe des im Kampf gefallenen Taira no Atsumori (1169-1184), nachdem sie sich aus Trauer über den Tod ihres Mannes als Nonne in den Tempel Mieidô in Kyôto zurückgezogen hatte, den dortigen Abt von hohem Fieber, indem sie Beschwörungsformeln sprach und ihm dabei mit einem aus Papier gefalteten Fächer Luft zuwedelte. Daher gelten gerade die Priester des Mieidô als besonders geschickte Fächerhersteller, und bis heute zählt Kyôto zu den Zentren der Fächerproduktion in Japan.
Während man in Deutschland oft dankbar ist, wenn die Sonne scheint, wird sie in Japan aufgrund der hohen Sommertemperaturen eher als etwas empfunden, gegen das man sich zu schützen hat. Ähnlich wie in Europa, als einst die oberen Bevölkerungsschichten es vermieden, sich direkten Sonnenstrahlen auszusetzen, um nicht braun wie ein "gewöhnlicher" Landarbeiter zu werden, ist in Japan zumindest beim weiblichen Geschlecht heutzutage immer noch der Sonnenschirm (higasa) verbreitet. Anders als in Europa, wo er eher in seiner großen Ausführung auf Südbalkonen und -terrassen sowie auf sonnendurchfluteten Plätzen vor Restaurants Verwendung findet, führt ihn in Japan die Damenwelt im Sommer als individuellen Einzelschirm mit sich, der - oft aus zarter Spitze - ihre Eleganz unterstreicht und sie vor jeglichen Sonnenstrahlen schützt.
In der westlichen Welt gilt gebräunte Haut als schön und gesund, und gern sitzen Deutsche im warmen Sonnenschein und genießen den Sommer, der allerdings selten so warm und nie so feucht ist wie in Japan. Das japanische Schönheitsideal hingegen ist immer noch eine möglichst helle Haut. Daher werden auch im Alltag gern Sonnenlotionen mit hohem Lichtschutzfaktor verwendet, und heller Puder gehört zur Standardausrüstung der gepflegten Japanerin. Besonders ausgeprägt findet sich dieses Ideal in den weißgeschminkten Gesichtern und Nackenpartien der Geishas wieder, und aus der Heian-Zeit (794-1192) wissen wir, dass einst auch der adelige Mann von Welt sein Gesicht puderte, um diesem Ideal zu entsprechen. Allerdings gibt es heutzutage auch Jugendliche, die es als modisch ansehen, braun zu sein, beispielsweise die sog. gankuro ("schwarzes Gesicht"), denen man besonders in von jungen Leuten favorisierten Vierteln wie Shibuya oder Harajuku begegnen kann: sonnenbankgebräunte Japanerinnen mit gebleichtem Haar, hell geschminkten Lippen und blau umrandeten Augenpartien. Sie stellen jedoch im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eine Ausnahme dar.
Anders als in Deutschland kühlt es im Sommer in Japan nachts kaum ab. Daher spielen Kinder und gelegentlich auch junge Leute gern kimodameshi, eine Art Mutprobe, die für Gänsehaut sorgen und dadurch die Hitze erträglicher machen soll. Dabei besteht die Aufgabe darin, in gespenstischem Dunkel auf einem buddhistischen Friedhof bis zu einem vorher festgelegten, meist weit vom Eingang entfernten Grab zu laufen und einen Gegenstand von dort als Beweis seiner Tapferkeit zurückzubringen, während Schauder des Grauens einem über den Rücken jagen und man sich auf dem einsamen Gelände fürchtet. Man sieht daran, dass notfalls zu ungewöhnlichen Mitteln gegriffen wird, um der hohen Temperaturen Herr zu werden. Zum Glück gibt es allerdings für die Zartbesaiteteren weniger nervenaufreibende Möglichkeiten, sich mit dem japanischen Sommer zu arrangieren und ihm manch Positives abzugewinnen (siehe hierzu z.B. "Sommer in Japan" im JF Vol. 76 vom Juli 2001).