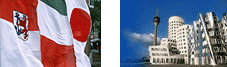Kultur und Austausch
Frühling in Japan:
(Japan Forum Vol. 97, April 2003, S. 1-2)
In den bekannten "Hundert Ansichten von Edo" (Meisho Edo hyakkei) von Andô Hiroshige (1797-1858), die nach den vier Jahreszeiten geordnet sind, nimmt der Frühling (haru) mit 40 der insgesamt 118 Holzschnitte den größten Raum ein. Schon daraus wird ersichtlich, welche Bedeutung Hiroshige dieser Jahreszeit beimaß - und damit steht er nicht allein. Auch in Gedichtsammlungen ist der Frühling gewöhnlich umfassend vertreten, zumal mancher Herrscher gern den Auftrag erteilte, die Schönheit dieser Jahreszeit in Verse zu fassen.
So begegnen uns Frühlingsmotive bereits frühzeitig in der Literatur, beispielsweise in der Gedichtanthologie Manyôshu ("Sammlung der zehntausend Blätter", 8. Jh.), in der u.a. das Veilchen (sumire) und die gelbe, mit ihren zarten Zweigen vom kleinsten Wind in Schwingungen versetzte yamabuki (japanisches Goldröschen) Erwähnung finden.
Beide sind ebenso Pflanzen des ausklingenden Frühlings wie die Malve (aoi). Nach ihr ist nicht nur ein eigenes Kapitel im Genji monogatari ("Geschichte vom Prinzen Genji", Anf. 11. Jh.) benannt, sondern auch das "Malvenfest" (aoi no matsuri), das jedes Jahr am 15. Mai in Kyôto mit einer Prozession zum Kamo-Schrein in Gewändern der Heian-Zeit (794-1192) begangen wird und auf das 8. Jahrhundert zurückgehen soll.
Als erste der vier Jahreszeiten umfasst der Frühling nach dem alten chinesischen Mondkalender den 1. bis 3. Monat, genauer gesagt: den Zeitraum vom sog. "Frühlingsbeginn" (risshun, um den 4. Februar) bis zum "Sommeranfang" (rikka, um den 6. Mai). Allerdings darf man nicht vergessen, dass diese aus China übernommenen Festlegungen den Witterungsverhältnissen, wie sie beispielsweise in Tôkyô vorherrschen, um rund einen Monat vorauseilen.
In der Meteorologie versteht man unter Frühling wie im Westen den Zeitraum von März bis Mai, und in der Astronomie setzt man den Frühling von shunbun ("Frühlingsmitte", um den 21. März) bis geshi ("Sommerwende", um den 21./22. Juni) an.
Nach der winterlichen Kahlheit scheint sich in der milden Frühlingsluft die Pflanzenwelt nahezu explosionsartig zu entwickeln. Das frische Grün - Kennzeichen des erwachenden Frühjahrs - erweckt den Eindruck praller, üppiger Fruchtbarkeit. Anfangs fällt es zwar schwer, die verschiedenen Pflanzenspitzen, die aus der Erde hervorlugen, voneinander zu unterscheiden. Vom warmen Regen benetzt, schießen diese jedoch rasch in die Höhe, präsentieren sich bald in all ihrer Pracht und sind dann leicht zu identifizieren.
Früh blicken lassen sich beispielsweise die "jungen Kräuter" (wakana) wie Kiefernschößling, Farnkraut (shida) und Schachtelhalmsprossen (tsukushi), das Adonisröschen (fukujusô) und der Löwenzahn (tampopo), dem Dichter allerdings erst in der frühen Neuzeit als "Blume des Feldes" Aufmerksamkeit widmeten. Das weiche Frühlingsgras (wakakusa) gilt im Gegensatz zu den Gräsern des Sommers und Herbstes als Sinnbild für Sanftheit.
Von besonderer farbiger Schönheit sind im April und Mai die hellvioletten Felder voller chinesischer Wicken (renge/rengesô, lat. Astragalus sinicus), die vor Setzen der Reisschößlinge weite Flächen bedecken; aus ihnen flechten sich junge Mädchen gern bunte Ketten und Kränze, auch gewinnt man aus ihnen einen speziellen Honig.
Auf Wandschirmen und anderen Kunstwerken sind als Frühlingsmotive außerdem u.a. Hirtentäschel (nazuna), Primel (sakurasô), Quitte (boke), Rapsblüte (nanohana), Ruhrkraut (hakogusa), Saubohne (soramame) und sogar die Blüte des Rettichs dargestellt, der als Gemüse normalerweise für Winter steht. Und ebenfalls nicht vergessen werden dürfen z.B. Magnolie (kobushi), Kamelie (tsubaki) und Schwertlilie (ayame), die den späten Frühling einläuten.
,Königin' des Frühlings ist unter dem Einfluss der chinesischen Dichtung jedoch anfangs die Pflaume (ume; eigentl.: japanische Aprikose), die selbst in hohem Alter auf knorrigsten Ästen zarte, weiße Blüten hervorbringt und, gelegentlich noch schneebedeckt, vom Winter in die wärmere Jahreszeit überleitet. Im Manyôshu ist sie eindeutig das dominierende Frühlingsmotiv, doch recht rasch erhält sie Konkurrenz durch die einheimische Kirschblüte (hana, eig. allgemein "Blume, Blüte"), die inzwischen längst das entscheidende Jahreszeitenwort (kigo) für den Frühling darstellt und nahezu synonym verwendet wird.
Normalerweise handelt es sich bei den japanischen Kirschbäumen (sakura) um Zierkirschen, sie tragen also keine Früchte, sondern werden wegen ihrer Blüte kultiviert; erst im ausgehenden 19. Jahrhundert gelangte die Esskirsche (sakurambo) aus Europa und China nach Japan.
Besonders oft abgebildet und bedichtet werden die Berg- und die Hängekirsche (yamazakura und yanagizakura bzw. shidarezakura), aber es existieren viele weitere Varianten, die uns überwiegend in Rosa, gelegentlich aber auch in Weiß- bis Rotschattierungen begegnen. Typisch ist der ausgefranste bzw. gezackte Rand der Blütenblätter, durch den sich die Kirschblüte auch auf Darstellungen in der Kunst deutlich von der Pflaumenblüte unterscheiden lässt.
Anders als die Pflaume, die eher dem Haus oder seiner näheren Umgebung, beispielsweise dem Garten, zugerechnet wird, gehört die Kirschblüte ursprünglich in den Außenbereich, oft gar in die Bergwelt. Daher muss sich der Mensch gewöhnlich aus seinen vier Wänden herausbewegen, um sie zu bewundern. So lockt sie im Frühjahr, wenn die Natur mehr und mehr zum Leben erwacht, die Japaner in großen Scharen in die Parks und Wälder, wo sie sich unter blühenden Baumkronen zur "Kirschblütenschau" (o-hanami) treffen.
In den Straßen werden Geschäfte, aber auch Telefon- und Strommasten mit Kirschblütenzweigen aus Plastik dekoriert, die allerdings hinter der Schönheit der natürlichen Kirschblüte deutlich zurückstehen. In Fischrestaurants erwarten die Besucher Frühlingsdelikatessen wie Venusmuscheln (hamaguri), Meerbrasse (tai) und Bonito (katsuo), und ab dieser Zeit steht auch Thunfisch (maguro) auf der Speisekarte; an den Gemüseständen laden Bambussprossen (takenoko) und frische Erdbeeren (ichigo) zum Zugreifen ein.
Bereits Mitte März, wenn die ersten Kirschblüten in Südjapan entdeckt werden, berichtet das Fernsehen Tag für Tag vom Vorrücken der "Kirschblütenfront" (sakura zensen) nach Norden. Gespannt verfolgt die Bevölkerung ihr Fortschreiten, und allerorts errechnet man, wann das Schauspiel die eigene Region erreichen wird - in Tôkyô ist dies meist die erste oder zweite Aprilwoche, allerdings kann sich je nach Wetterlage dieser Zeitpunkt auch deutlich nach vorn oder hinten verschieben. Ist die Kirschblüte bis in die nähere Umgebung vorgedrungen, beginnen die Vorbereitungen für o-hanami: Freunde werden kontaktiert, Verabredungen getroffen, Kissen, Matten und Decken zusammengesucht und Lunchboxen gepackt.
Am Wochenende unternimmt man gern mit der Familie oder Freunden einen Ausflug, um die Kirschblüten zu betrachten. Besonders berühmt sind die Kirschbäume in den Bergen von Yoshino (südlich von Nara, ehem. Provinz Yamato) und in Arashiyama (nahe Kyôto), die einst von Yoshino dorthin verpflanzt wurden; beide Regionen ziehen Jahr für Jahr viele Tausende Besucher an und begegnen uns häufig in Gedichten und auf Kunstwerken.
Hiroshige fängt in einem seiner frühen Holzschnitte (Gotenyama yukô, um 1832/34) die gelöste Stimmung der Kirschblütenschau gelungen ein: Man sitzt unter den Bäumen, unterhält sich, isst und trinkt, spielt, musiziert, tanzt und geht spazieren; immer wieder hebt man staunend den Blick, genießt die Blütenpracht oder schaut entspannt auf das Meer hinaus, auf dem sich Segelboote tummeln - ein weiteres Motiv des beginnenden Frühlings.
Dem Berufstätigen bleibt werktags allerdings oft nur die Mittagspause oder die Zeit nach der Arbeit zur Kirschblütenschau. Manche Firmen schicken Angestellte aus, die im Park einen schönen Platz für die Kollegen zu reservieren suchen, an dem man sich schließlich gemütlich zusammenfindet.
Man sitzt im Kreise, in dessen Mitte die Leckereien ausgebreitet werden, damit jeder ungehindert zugreifen kann, plaudert über Arbeit und Familie und freut sich an den blassrosa Blütenblättern, die sich in der Teeschale oder im Sakebecher spiegeln und gelegentlich lautlos herabschweben. Und so kann es passieren, dass man bis tief in die Nacht zusammensitzt, ehe die letzte Bahn dem Beisammensein ein Ende setzt, während längst Glühbirnen statt Sonnenstrahlen das Blütenmeer erleuchten.
Hotelzimmer mit Panoramafenstern auf für ihre Kirschblüte bekannte Gärten und Parks - beispielsweise am Kaiserpalast in Tôkyô - sind trotz horrender Preise zu dieser Zeit rasch ausgebucht, bieten sie doch die Möglichkeit, bequem und unabhängig von den Witterungsverhältnissen die Schönheit der Natur zu genießen. Denn obwohl die Temperatur im Frühjahr ansteigt, kann es ab und zu zur Kirschblütenzeit noch recht kühl sein. Auch Regen ist möglich, so dass ein Schluck warmen Reisweins erheblich zum Wohlbefinden beizutragen vermag.
Als typisch gilt auch der morgendliche Frühlingsdunst (kasumi), von dem in der Literatur gelegentlich die Rede ist; dabei handelt es sich - im Gegensatz zum kalten Nebel des Herbstes (kiri) - um die Bündelung der Feuchtigkeit in sich allmählich erwärmender Luft, die in der Frühe über dem Boden steht und sich stimmungsvoll mit dem Rosa der Kirschblüten mischt.
Die Kirschblütenpracht ist nur von relativ kurzer Dauer. Bereits nach anderthalb bis zwei Wochen kann alles vorbei sein. Ehe man sich versieht, sinken die Blätter zu Boden oder werden vom Wind wie Schneeflocken davongetrieben, und nur ein allmählich verwehender bräunlicher Blütenteppich erinnert an die Zeit der zartrosa Kirschblütenwolken.
Aufgrund dieser kurzen Blütezeit ist die Kirschblüte auch ein Symbol für den tapferen Krieger, der von einem Moment auf den anderen im aufopferungsvollen Kampf sein Leben verlieren kann, ja sogar ein Gleichnis für das Leben des Menschen generell.
Damit ist die Kirschblüte bei all ihrer Prachtentfaltung zugleich ein Hinweis auf die Vergänglichkeit allen Seins; ihr Verwelken und Abfallen ruft beim Betrachter Melancholie hervor - eine Stimmung, die bereits frühzeitig in die japanische Lyrik Eingang fand, beispielsweise als Klage über die viel zu früh abgerissenen Blüten oder als Bitte an den Wind, die Kirschblüten noch ein klein wenig zu verschonen.
Gern mit Kirsch- oder Pflaumenblüten oder einem Weidenzweig kombiniert wird der Buschsänger (uguisu, auch als "japanische Nachtigall" bezeichnet), dessen von allen herbeigesehnter Ruf vom Ende der Winterzeit kündet und damit den Beginn des Frühlings markiert. Das heutzutage für ihn gebräuchliche Schriftzeichen enthält neben dem Radikal für "Vogel" auch zweimal das Zeichen für "Feuer" - ein Hinweis darauf, dass diesem Tier nach der Kälte der vergangenen Monate wärmende, die Lebensgeister weckende Kräfte zugeschrieben werden.
Ebenfalls typisch für den Frühling ist die Feldlerche (hibari), die sich nicht nur durch ihren Gesang, sondern auch durch ihre munteren Bewegungen auszeichnet, mit denen sie voller Dynamik durch die Luft gleitet. Und auch der prachtvoll gefiederte Fasan (kiji) tritt gerade in der Kunst gelegentlich als Frühlingsmotiv auf, speziell für den 2. Monat des chinesischen Mondkalenders (ungefähr April). Überhaupt belebt sich die Tierwelt: Die Schlangen (hebi/veraltet: kuchinawa) kommen aus ihren Löchern hervorgekrochen, es zeigen sich Wasserschnecke (tanishi), Bremse (abu) und Frosch (kaeru/kawazu), die kleinen Bachforellen (koayu) lassen sich leicht fangen, und die Katzen gehen auf Partnersuche (neko no tsumagoi), so dass man hört, wie allerorts Kater lautstark um Weibchen werben.
Während einige Schmetterlinge wie der Schwalbenschwanz dem Sommer zugerechnet werden, treffen wir in Darstellungen des Frühlings auf Kohlweißling und Muschelfalter, wie sie über Rapsblüten oder anderen Frühjahrsblumen flattern. Die Wildgans (kari) hingegen verlässt im Frühjahr Japan, um in kältere Gebiete zu ziehen, und kehrt erst im Herbst zurück, ist daher Sinnbild herbstlicher Einsamkeit wie der Hirsch (shika) mit seinem klagenden Röhren, bei dem allerdings der Abwurf des Geweihs (tsuno) wiederum für den Frühling steht.
Beliebt ist im Frühjahr die frisch ergrünte Trauerweide (yanagi), deren Weidenkätzchen (neko-yanagi) als Vorboten des Frühlings gelten; mit ihrem grazilen Wuchs und ihren biegsamen, an Frauenhaar erinnernden Zweigen wird sie als Inbegriff weiblicher Anmut angesehen und daher gern in Kunst und Literatur thematisiert, oft am Rand eines Gewässers stehend, zu dem sie sich entgegenkommend herabzubeugen scheint. Auch die mit Steinen beschwerten Körbe (jakago) zur Uferbefestigung sind typisch für den Frühling und tauchen bereits im 9. Jahrhundert in japanischen Gedichten auf.
Nicht nur in der Natur bricht mit dem Frühling eine neue Phase an, auch sonst ist in Japan das Frühjahr eine Zeit des Wandels bzw. sogar des Übergangs in einen neuen Lebensabschnitt: Schuljahr und Universitätsstudium beginnen im April mit der offiziellen Aufnahmefeier (nyugakushiki), meist tritt man nach Studienende in diesem Monat seine erste Arbeitsstelle an, und auch das japanische Fiskaljahr startet in vielen Institutionen am 1. April und reicht dann bis zum 31. März des nächsten Jahres. Vielleicht hat man tatsächlich ganz bewusst die Kirschblütenzeit für diese Zäsur gewählt, um durch die Schönheit der Natur den Eintritt in den ,Ernst des Lebens' erträglicher zu machen.
Neben verschiedenen Frühlingsfesten (haru-matsuri), wie sie von Tempeln und Schreinen begangen werden, gibt es in den Frühlingsmonaten März bis Mai inzwischen fünf gesetzliche Feiertage: shunbun no hi ("Frühlingsanfang", 20. oder 21. März), midori no hi ("Tag des Grüns", 29. April), kempô kinen-bi ("Tag der Verfassung", 3. Mai), kokumin no kyujitsu ("Tag des Volkes", 4. Mai) und kodomo no hi ("Kindertag", 5. Mai); da die drei letzten Feiertage eng beeinander liegen, werden sie in Verbindung mit Brückentagen als "Golden Week" gern für einen Kurzurlaub genutzt.
In den sieben Tagen um den Frühlings- wie auch um den Herbstanfang erweist man eine Woche lang nach buddhistischem Ritus seinen verstorbenen Familienangehörigen Respekt; man spricht hierbei von higan. Weniger bekannt ist der Geburtstag des historischen Buddha Shakyamuni (Seitan'e) am 8. April, der - da er in die Kirschblütenzeit fällt - auch als "Blumenfest" (hana-matsuri) bezeichnet wird.
Als eines der fünf Jahresfeste (go-sekku), bei dem es sich jedoch nicht um einen gesetzlichen Feiertag handelt, findet am 3.3. für Mädchen das Puppenfest (hina-matsuri) statt, an dem das Kaiserpaar mit seinem im Stil der Heian-Zeit gekleideten Hofstaat aufgebaut wird, gern dekoriert mit Pfirsichzweigen (momo) als Zeichen weiblicher Schönheit. Beim tango no sekku ("Knabenfest") am 5.5., das unter der Bezeichnung "Kindertag" (kodomo no hi) seit 1948 offizieller Feiertag ist, stehen stattdessen die Jungen im Mittelpunkt. Blume des Tages ist dann die Schwertlilie; sie, die zu diesem Anlass aufgestellten Puppen von Kriegern und anderen Helden, Helm und Rüstung sowie die Karpfenbanner (koinobori), die draußen gehisst werden, stehen für männliche Stärke, Mut und Ausdauer und sollen den Wunsch unterstreichen, dass die Söhne des Hauses gesund, kraftvoll und tapfer heranwachsen mögen.