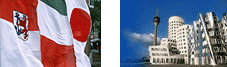Kultur und Austausch
Schönheitsideale und Schönheitspflege in Japan:
(Japan Forum Vol. 95, Februar 2003, S. 1-2)
Wer sich auf alten Bildrollen (emakimono) zum Genji monogatari ("Geschichte vom Prinzen Genji", Anf. 11. Jh.) Prinz Genji, den "leuchtenden Prinzen" und alles überstrahlenden Helden des Romans, anschaut, ist nicht selten leicht enttäuscht. Denn die dargestellte Person mit ihrem winzigen Mund, ihren schmalen Augen, dem fast teigig wirkenden, pausbäckigen Gesicht und dem spärlichen Kinnbärtchen, deren Figur unter den zahlreichen Kleidungshüllen nur schwer auszumachen ist, entspricht kaum unserer heutigen Vorstellung eines Mannes, dessen Schönheit und Anmut einst seine Umgebung bezaubert und die von ihm hingerissenen Frauen der Ohnmacht nahe gebracht haben soll. Auch ein Blick auf Fujiwara no Korechika (975-1010), den Traummann der damaligen Zeit, der nach Vermutung vieler Forscher Murasaki Shikibu als historisches Vorbild für die Figur des Genji diente, zeigt, dass sein rundes Mondgesicht offensichtlich dem Ideal der Zeit entsprach.
In der Heian-Zeit (794-1192) galt eine eher füllige Figur als attraktiv, zumal sie einen gewissen Wohlstand verkörperte. Daher wurden besonders schöne Frauen in der damaligen Literatur gern mit Formulierungen wie tsubutsubu to fuetaru ("wohlgerundet und mollig") oder fukuraka naru hito ("eine rundliche Person") beschrieben; magere, knochige Menschen hingegen fand man hässlich. Erst mit Ausklang des 12. Jahrhunderts wandelte sich das Ideal, und allmählich gewannen schlanke, gestreckte Figuren an Beliebtheit, wie sie uns beispielsweise in Holzskulpturen der Kamakura-Zeit (1192-1333) und in den Holzschnitten des 18. und 19. Jahrhunderts begegnen.
Obwohl die oben genannten emakimono nicht in der Heian-Zeit, sondern erst später entstanden, kann man davon ausgehen, dass die Künstler mit ihrer Darstellung tatsächlich das Schönheitsideal der Oberschicht der Heian-Zeit trafen, das damals - beeinflusst von der chinesischen Kultur der Tang-Zeit (618-907) - gleichermaßen für das weibliche wie für das männliche Geschlecht galt. Allerdings handelte es sich bei dieser höfischen Elite um eine zahlenmäßig sehr begrenzte Gruppe, die sich den schönen Künsten widmete und ihr ästhetisches Empfinden an Fragen wie der passenden Farbkombination einzelner Gewänder oder der Konzeption und eleganten Niederschrift eines Gedichtes schulte und weiterentwickelte. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hingegen lebte in einer anderen Welt und musste zur Aussaat oder Erntezeit tatkräftig zupacken, um ihr Überleben zu sichern. Insofern lässt sich das hier beschriebene Schönheitsideal nicht verallgemeinern.
Ursprünglich war das Schminken - im Japanischen mit dem Begriff keshô ("verwandeln" + "schmücken") bezeichnet - eng mit magisch-religiösen Praktiken verbunden: Durch Auftragen von Ocker und Rot versuchte man, sich auch körperlich auf die kultische Handlung vorzubereiten und die damit verbundene geistige Wandlung zu unterstützen. Als der Buddhismus im 6. Jahrhundert über Korea nach Japan gelangte und mit ihm viele weitere Komponenten chinesischer Kultur übernommen wurden, setzten sich am Kaiserhof andere ästhetische Vorstellungen durch: Als schön angesehen wurde nun eine möglichst helle Haut, die - ähnlich wie in Europa - als Zeichen des Wohlstandes und der edlen Herkunft galt und zu der das dunkle Haar und der zu einer Rosenblüte stilisierte rote Mund mit den geschwärzten Zähnen einen Kontrast bildeten, der im Halbdunkel der Paläste sehr eindrucksvoll gewirkt haben muss. Diese an Schneewittchen erinnernde Farbkombination sollte über viele Jahrhunderte aktuell bleiben.
Aber von Natur aus verfügten nur wenige über den als ideal empfundenen hellen Teint. Daher griffen Damen wie Herren bei Hofe bereits frühzeitig zu reichlich weißem Puder, um die gewünschte Blässe zu erzielen - ein Brauch, der ähnlich in späteren Jahrhunderten auch an europäischen Höfen praktiziert wurde. Ursprünglich verwendete man als Puder eine Mixtur aus Kaolin und Reismehl, ab dem 7. Jahrhundert wurde diese Mischung durch aus China eingeführtes Kupferchlorid (keifun) und weißes Blei (empaku) ersetzt. Allerdings war diese weiße Schminke (oshiroi) als Importware recht kostspielig und damit lange Zeit nur für den Hofadel erschwinglich. Erst mit dem wachsenden Wohlstand des städtischen Bürgertums trat eine neue Käuferschicht auf, die sich ebenfalls derartige Kosmetika leisten konnte. Allerdings galt in Edo, dem heutigen Tokyo, Anfang des 17. Jahrhunderts für kurze Zeit das ungeschminkte Gesicht als besonders schön - sofern es vornehm blass aussah, was jedoch nicht jedem gegeben war. So griff man rasch wieder zu oshiroi - vor allem zum Bleipulver -, und bald wagte sich ohne Schminke keine Frau mehr in die Öffentlichkeit. Das Pulver wurde mit Wasser zu einer Paste verrührt und dann auf die Haut aufgetragen. Dabei widmete man neben Gesicht und Hals dem Nacken große Aufmerksamkeit, da diesem in Japan besondere erotische Wirkung zugesprochen wurde; je größer die am Kimono-Kragen sichtbare Nackenpartie war, desto aufgeschlossener galt die Dame in Liebesdingen. Auch wenn diese Auslegung heutzutage nicht mehr zutrifft, kann man den sorgsam geschminkten Nacken heutzutage noch bei Geishas und maiko (jungen Frauen, die zur Geisha ausgebildet werden) bewundern. Als in den 1870er Jahren entdeckt wurde, wie giftig die bleihaltige Schminke war, suchte man nach einem gefahrlosen Ersatzstoff, der in Japan allerdings erst 1905 auf den Markt kam. Heutzutage ist längst die Grundierung an die Stelle dieser traditionellen Schminke getreten.
Rot, die zweite Farbe im Schönheitskanon, kam auf weißgeschminkter Haut natürlich besonders gut zur Geltung. Bereits auf den tönernen Grabfiguren (haniwa) des 3. bis 6. Jahrhunderts finden sich Spuren rötlicher Farbe, die allerdings als eine Art rituelles Make-up identifiziert wurden und daher nicht als Vorläufer des späteren Rouge gelten. Im frühen 7. Jahrhundert erreichte die Färberdiestel (benibana) aus Ägypten über Indien, Zentralasien, China und Korea auch Japan; aus ihr konnte Karmesinrot (beni) gewonnen werden, das aufgrund seiner leuchtenden Farbgebung als Symbol für Freude und Glück angesehen wurde. Im 10. Jahrhundert gelang es, die Pflanze in Japan anzusiedeln; allerdings war der Anbau mühevoll und der Ertrag gering, so dass beni ein kostbarer Luxus blieb und dementsprechend sparsam zum Einsatz kam. Man verwendete es hauptsächlich zur Hervorhebung des Mundes, auf den es mit einem kleinen Pinsel appliziert wurde, manchmal ergänzt durch eine Spur Rouge auf den Wangen oder etwas Rot in Augenwinkel oder Augenlid. Im ausgehenden 18. Jahrhundert trat die Rouge-Variante sasabeni mit dem ihr eigenen goldenen Grünschimmer auf, die sich großer Beliebtheit erfreute; sie wurde übrigens - der damaligen Mode entsprechend - auf der Unterlippe intensiver aufgetragen als auf der Oberlippe. Gegen Ende der Meiji-Zeit (1868-1912) übernahm man jedoch westliches Rouge, und damit kam der traditionelle Farbstoff außer Gebrauch.
Den krönenden Abschluss im Farbtrio bildete das schwarze Kopfhaar (vgl. Artikel "Frisuren in Japan", in: Japan Forum Vol. 80, Nov. 2001), das eines der wichtigsten Schönheitsmerkmale einer Frau darstellen konnte und als solches von der Hofdame Sei Shônagon in ihrem "Kopfkissenbuch" (Makura no sôshi, Anf. 11. Jh.) mehrfach ausdrücklich erwähnt wird. Im Idealfall ist das Haar voll, glatt und körperlang und fällt dekorativ über die Schultern nach hinten. In der Literatur finden wir immer wieder Episoden, in denen davon berichtet wird, wie sich ein Mann allein beim Anblick des langen, üppigen Haares einer Frau in diese verliebt.
Als schön galt überdies eine hohe Stirn. Um den Eindruck zu verstärken, eine solche zu besitzen, rasierte man beispielsweise die Stirnhaare aus und versetzte außerdem die Augenbrauen nach oben. Hierzu wurden die natürlichen Brauen ausgezupft oder wegrasiert (okimayu) - ein Brauch, der bereits im China der frühen Han-Zeit (206 v.-8 n.Chr.) existiert hatte. Danach überschminkte man die alten Stellen und malte stattdessen einige Zentimeter darüber mit dem Pinsel neue Brauen (mayuzumi), deren kunstvolle Form in der klassischen Dichtkunst gern metaphorisch mit einer Mondsichel oder einem Schmetterlingsflügel verglichen wurde. Als Farbe diente anfangs mit Asche vermischter Schwarzton, danach mit den Resten verbrannter Reisähren versetzter Lampenruß, ehe man in der Heian-Zeit eine spezielle Paste (konezumi) aus Rouge, Lampenruß, Blattgold, Extrakt der asiatischen blauen Dreimasterblume (Commelina communis) und Sesamöl entwickelte. In der Edo-Zeit (1603-1867) wurden vielerlei Schönheitstechniken - darunter auch mayuzumi - verfeinert; sie verbreiteten sich in der gesamten Bevölkerung, und die größere Nachfrage begünstigte die industrielle Herstellung kosmetischer Utensilien, die bald nahezu jeden Toilettentisch schmückten und von hohem kunsthandwerklichen Wert sein konnten.
In der Heian-Zeit wurde mayuzumi in der Oberschicht auch zur Kennzeichnung der Volljährigkeit bzw. Geschlechtsreife junger Mädchen, die diese meist mit 12-13 Jahren erreichten, verwendet und z.T. wie eine Art Initiationsritus vollzogen, oft in Verbindung mit dem ersten Ausrasieren der Stirnhaare und dem Schwärzen der Zähne (ohaguro bzw. kane). Letzteres stammt - im Gegensatz zu vielen anderen in Japan üblichen Schönheitsbräuchen - offensichtlich nicht aus China und Korea, sondern aus Südostasien oder Polynesien. Zum Färben der Zähne verwendete man eine Mixtur aus Eisenspänen oder Eisennnägeln, die in Tee, Reiswein o.ä. eingelegt wurden und dort oxidierten; die so entstandene schwarze Tunke wurde dann mit einem weichem Pinsel und mit Hilfe von Haftpulver auf die Zähne aufgetragen. Schwarze Zähne galten damals als erotisch - eine Vorstellung, die westliche Betrachter heutzutage oft nur schwer nachvollziehen können -; außerdem glaubte man, durch Schwärzen die Zähne gesund zu erhalten, und nebenbei wurde durch die eisenhaltige Substanz einem eventuellen Eisenmangel in der Schwangerschaft entgegengewirkt. Ab dem 12. Jahrhundert begannen auch Männer des Hof- und des Schwertadels, sich die Zähne zu färben, später übernahm das Bürgertum diese Sitte. Geschwärzte Zähne zeigten nun an, dass die Frau entweder bereits verlobt oder verheiratet war; die zum Schwarzfärben erforderlichen Utensilien waren daher Bestandteil der Aussteuer. Eine Witwe, die sich weiterhin die Zähne schwärzte, machte dadurch deutlich, dass sie eine Wiederverehelichung nicht anstrebte. Im 18. Jahrhundert wurde Männern das Zähneschwärzen verboten, 1871 weitete die Meiji-Regierung schließlich per Kabinettsbeschluss dieses Verbot auch auf das weibliche Geschlecht aus, da dieser Brauch nun unter westlichem Einfluss als barbarisch eingestuft wurde.
Das Ideal heller Haut sowie einer vollen, runden Gesichtsform galt in der Heian-Zeit für Frauen und Männer gleichermaßen - zumindest nach dem Geschmack verfeinerter Hofdamen wie Murasaki Shikibu. Mehrfach charakterisiert sie im Genji monogatari einen Mann dadurch als gutaussehend, dass sie seine Ähnlichkeit mit einer Frau hervorhebt. Auch die Vorstellung, dass ein edler Herr - von Gefühlen überwältigt - diesen durch Tränen Ausdruck verleiht, galt damals keineswegs als Zeichen der Schwäche und Verweichlichung, sondern bezeugte die hohe Empfindsamkeit des Betreffenden. Über die äußere Erscheinung wurden ansonsten relativ wenige Worte verloren; als aussagekräftiger erschien die Fähigkeit, eine Stimmung in Versen einzufangen, das passende Papier für die Niederschrift des Gedichts auszuwählen oder ein besonders ansprechendes Räucherwerk zu kreieren, mit dem man seine Kleidung parfumieren und dadurch sein Kommen und Gehen aufs angenehmste signalisieren konnte. Darin soll Prinz Genji wahre Meisterschaft erlangt haben, und auch die Namen zweier weiterer Personen in Murasaki Shikibus Roman - "Prinz Duft" (Niou no miya) und "Fürst Wohlgeruch" (Kaoru Dainagon) - belegen, welche Bedeutung der Duftkunst in jener Zeit beigemessen wurde. Sie diente dabei einem durchaus praktischen Zweck; denn angesichts der Tatsache, dass man damals relativ selten badete und die kostbaren Stoffe schwierig zu reinigen waren, ließ sich die körperliche Präsenz der Mitmenschen manchmal leichter ertragen, wenn sonstige Gerüche vom Duft der Gewänder überlagert wurden.
Es gab noch viele andere Kosmetika, von denen hier nur einige wenige aufgezählt werden können. Beispielsweise übernahm man von Portugiesen, Holländern und Spaniern im 16. und 17. Jahrhundert die Herstellung von Hautlotionen und Duftwässerchen. Zur Körperreinigung beim Baden diente ein Reiskleie-Säckchen (nukabukuro), für die Gesichtspflege griff man gern auf Gemüsesäfte wie Kürbislotion (hechima-sui) und Gurkenwasser zurück. Und als wahres Wundermittel für eine helle und zarte Haut galt Nachtigallenkot (uguisu no fun). Wie Untersuchungen inzwischen gezeigt haben, enthält dieser u.a. wichtige aufbauende Enzyme - dennoch bleibt dem Laien verborgen, wie man einst gerade auf diese hilfreiche Substanz gestoßen sein mag.
In vielerlei Hinsicht hat sich der Geschmack inzwischen geändert, und die alten Schminktechniken finden heutzutage weitgehend nur noch in den traditionellen Künsten Anwendung, vor allem bei den einstigen Trendsettern: den Kabuki-Schauspielern, Geishas und maiko. Geschwärzte Zähne und rasierte, nach oben versetzte Augenbrauen sind längst "out", und statt einer rundlichen Gestalt favorisiert man inzwischen eine schlanke, zierliche Figur. Eine Schönheitsvorstellung vergangener Zeiten hat sich allerdings bewahrt: Noch heute wünschen sich die meisten Japanerinnen eine helle Haut - ganz anders als in Mitteleuropa, wo der sonnengebräunte Teint als gesund und sportlich gilt. Daher führen japanische Frauen gewöhnlich hellen Puder mit sich und ziehen im Sommer den Schatten vor, während viele Deutsche von der Sonne nicht genug bekommen können - allen Unkenrufen der Hautärzte zum Trotz.
Wie es einst auf die Zeitgenossen wirkte, wenn jemand nicht bereit war, sich dem geltenden Schönheitsideal zu unterwerfen, wird in der Erzählung Mushi mezuru himegimi ("Die Dame, die Insekten liebte", spätes 12. Jh.) geschildert: Als die exzentrische Protagonistin es ablehnt, dem Modediktat ihrer Zeit zu entsprechen, ihre Augenbrauen zu entfernen und ihre Zähne zu schwärzen, ruft dies bei ihren Dienerinnen regelrecht Ekel hervor; sie vergleichen angewidert die natürlich gewachsenen Augenbrauen mit haarigen Raupen, und ein potentieller Heiratskandidat nimmt, als er der weiß blitzenden Zähne seiner potentiellen Braut ansichtig wird, von seinem Vorhaben Abstand. Da beruhigt es sehr, dass heutzutage erlaubt ist, was dem Einzelnen gefällt, und derjenige, der den aktuellen Modetrend nicht mitmacht, derartig drastische Reaktionen kaum zu befürchten hat.